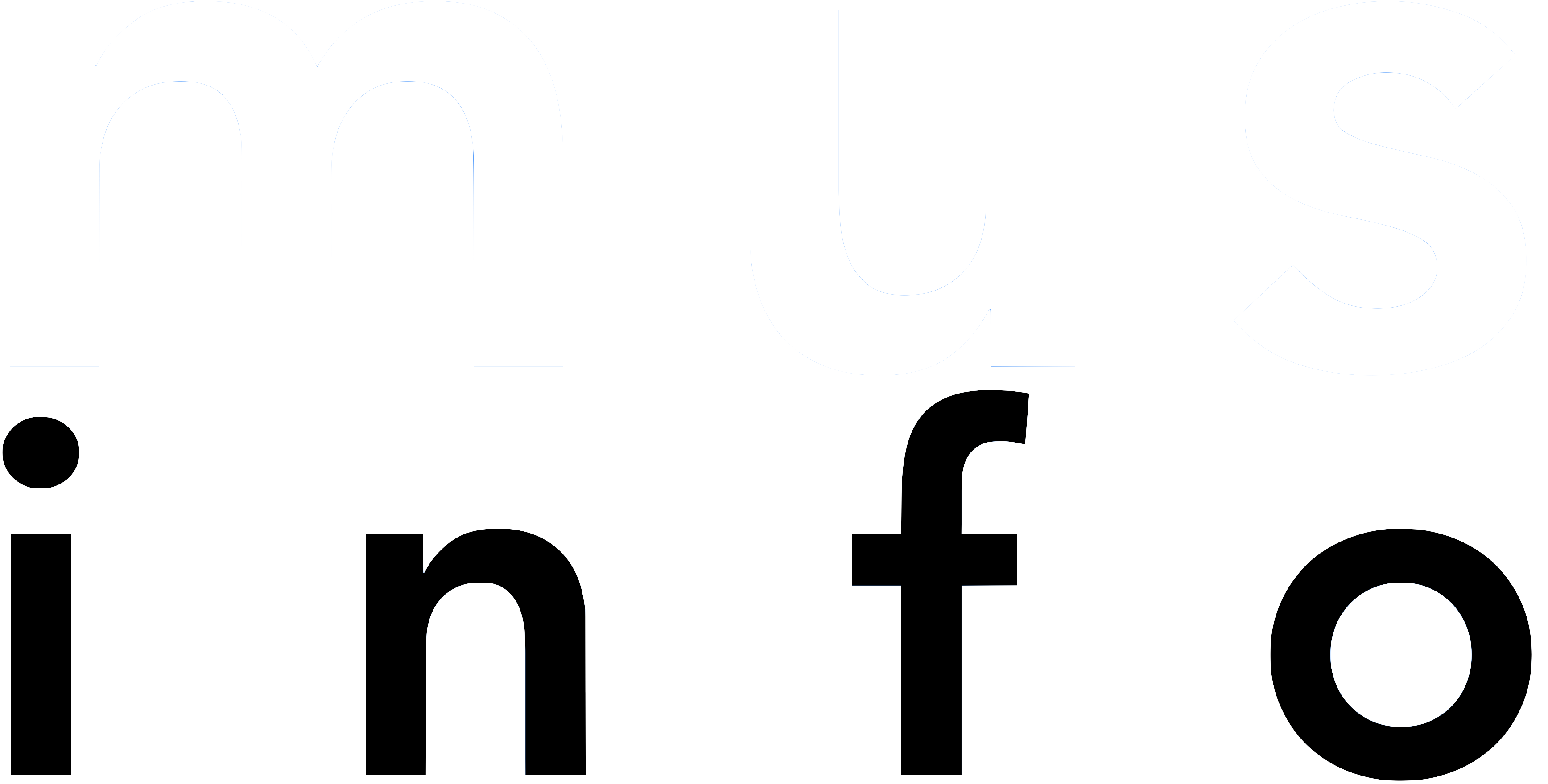Mit nordischem Akzent
Die Tage für Neue Musik Zürich 2010 (10. bis 14. November)
Die alte Dame «Neue Musik» tragen sie im Namen, die Zürcher Tage für Neue Musik, und auch an Alterswürde fehlt es ihnen nicht – kaum der gerademal 24 Lenze wegen, eher schon der Ehre der Anciennität zufolge: Das von Gérard Zinsstag und Thomas Kessler 1986 gegründete Festival war hierzulande wohl das erste Festival für zeitgenössische Musik, das nicht nur mit Herzblut, sondern auch mit ernstzunehmendem Budget und daher wahrnehmbar grosser Kelle agieren konnte. Finanzielle Solidität stand aber auch diesem Festival nicht durchwegs Pate, in einer bedrohlichen Situation übernahm die Stadt Zürich 1994 die Trägerschaft des Festivals und sicherte damit dessen Zukunft – und die Deckung des Budgets, das sich heute auf rund eine Viertelmillion Schweizer Franken beläuft. Walter Feldmann wurde damals als künstlerischer Leiter beigezogen (und spätestens mit ihm fand das emphatisch grosse «N» der «Neuen Musik» Niederschlag in der Programmierung), etwas später kam Mats Scheidegger dazu, der heute noch – nun zusammen mit Nadir Vassena – für die künstlerische Leitung verantwortlich zeichnet.
Von Beginn an waren die Tage für Neue Musik nicht als Uraufführungsfestival konzipiert, vielmehr galt der Fokus einer Art Repertoirepflege (oder eher: einem Repertoireaufbau): Werke, die in der Schweiz noch nie gespielt wurden, sollten bekannt gemacht werden, geschichtliche Bezüge herzustellen war nie verboten. Dies blieb bis heute unverändert, «neu» gilt dem Festival nicht als Kategorie des Alters, sondern der Rezeption – und so steht 2010 auch Werken wie Franco Evangelistis Aleatorio für Streichquartett (1959), Edgar Varèses Ecuatorial (1932–34) oder Francisco Guerreros Concierto de camara (1978) keine Altersguillotine im Weg.
Programmatische Schwerpunkte waren und sind zumeist personengebunden, so auch 2010: der Norweger Rolf Wallin (geb. 1957), der Däne Christian Winther Christensen (geb. 1977) sowie der Franzose Philippe Leroux (geb. 1959) erhielten eine Plattform. Die gelassen internationale Haltung des Festivals zeigt sich in dieser Wahl ebenso wie in der knappen Vertretung Schweizer Komponisten sowie in der Auswahl der eingeladenen Ensembles: Das Sonar Quartett Berlin, das Het Nieuw Ensemble Amsterdam, die Athelas Sinfonietta Kopenhagen oder das Quatuor Diotima. Auch das Tonhalle-Orchester Zürich – 2009 die grosse Abwesende – war wieder mit von der Partie und sorgte mit Varèses Ecuatorial (Bass: Otto Katzameier) und Witold Lutosławskis Cellokonzert (1969–70; Cello: Anita Leuzinger) für Höhepunkte, allerdings solche, denen schal anhaftete, dass sie eigentlich eher ins reguläre Tonhalle-Programm gehörten denn an die Tage für Neue Musik. Immerhin: David Zinman, seit vielen Jahren Chefdirigent in Zürich, machte sich gar die Mühe, mit Plus loin (1999–2000) von Philippe Leroux ein zumindest an der Oberfläche höchst komplexes Orchesterwerk neu einzustudieren. Leroux exponiert darin immense Klangmassen, verliert sich aber rasch im spektralen Nähkästchen und treibt dann über die verbleibenden 20 Minuten riesenhafte Mixturen spektralen Skalen entlang auf und abwärts. Die massige Redseligkeit dieses Werks lässt jedenfalls kaum erahnen, welche gestische Präzision Leroux in Voi(Rex) für Stimme, sechs Instrumente und Elektronik (2002) erreicht – sensationell umgesetzt durch Donatienne Michel-Dansac (Stimme) und die Athelas Sinfonietta mit Pierre-André Valade (zu Voi(Rex) siehe dissonance 90, S. 4–13).
Als Entdeckung des Festivals darf wohl Christian Winther Christensen gelten: Frei nach nordischen Klischees verliert der junge Däne kaum Worte und auch kaum Töne, seine treue Begleiterin, eine Baseballkappe, wirft unablässig ihren Schatten über die Augenpartie des Komponisten – ein schwer zu durchschauender Mensch, eine schwer zu durchschauende Musik. Für das Zürcher Festival und für die Athelas Sinfonietta schrieb er eine Festmusik – mit japanischem Geist und deutschem Akzent (2010), die sich in lakonischer Ironie und mit konzisem Hintersinn auf die Japanische Festmusik op. 84 (1940) von Richard Strauss bezieht – einem Auftragswerk des Dritten Reiches und Geschenk ans japanische Kaiserreich, laut Christensen das schlechteste aller Strauss-Werke. Kaum mehr als leise auftauchende Dur- und Mollakkorde (das Material entnahm Christensen dem Finale von Beethovens Neunter) und eine differenzierte Geräuschkulisse benötigt der junge Komponist, um die Grundbausteine der tonalen, europäischen Musik mindestens so fern und fremd erscheinen zu lassen wie das japanische Kaiserreich (oder das Organum des europäischen 12. Jahrhunderts, dem Christensen die in dieser Festmusik eingesetzte, parallelführungsreiche Satztechnik abluchste). Die Entwicklung des noch schmalen Werkkatalogs von Christensen zu verfolgen, dürfte ein lohnendes Unterfangen sein.
Für höchst kontroverse Reaktionen sorgte Rolf Wallin mit Strange News für einen afrikanischen Schauspieler, Ensemble, Video und Surround-Beschallung (2007): Die Wände des Konzertsaals einzureissen und die Realität herein zu holen, ist die Absicht dieser «musikalischen Parallele zu einem TV-Dokumentarfilm» (Wallin). Als schonungslose Anprangerung eines so dunklen wie aktuellen Kapitels der Zeitgeschichte Zentralafrikas – dem Missbrauch von Kindern als Kindersoldaten bzw. der Gehirnwäsche, die Kinder in kalte Tötungsmaschinen verwandelt – versteht Wallin seine Strange News. Allein: Der Grat zwischen einer über sich hinaus weisenden, engagierten Musik und der Ausbeutung fremden Leides zu eigenen Zwecken – dieser Grat ist schmal. Mit einem ähnlichen Grat haben Hilfswerke regelmässig zu kämpfen, und in der Tat mochte man wähnen, dieses Werk sei der Werbespot eines Hilfswerks mit einem Zug zum Missionarischen. Betroffenheit wird zum Ornament, gar zum Lebenselixir einer belanglosen Musik, die Grausamkeit der Weltgeschichte wird zum Selbstbedienungsladen. Die Problematik dieses Werks ist grosso modo dieselbe, vor der Schostakowitsch gestanden wäre, hätte er zu seinen Symphonien Surround-Panzerlärm und -Stalinreden auf die Zuhörer einprasseln lassen, auf dass bloss niemand etwas falsch verstehen möge.
Auch Martin Luther King musste Wallin als Lieferant eines semantischen Stimulans dienen: In Concerning King für Streichquartett und Video (2006/09) unterzieht Wallin eine Rede Kings Frequenz- und weiteren Analysen, um das dadurch gewonnene Material kompositorisch zu verwenden. Das Resultat allerdings gerät denkbar banal: Das Streichquartett beschränkt sich aufs blosse Illustrieren von Sprachmelodie und -rhythmus der vollständig abgespielten Rede – als wäre sie die Vorlage eines Ausmalbildes. Ein Beispiel dafür, wie semantische Ebenen, denen die Verwurzelung in der Musik fehlt und die in ihr auch kein ebenbürtiges Gegenüber finden, fast zwangsläufig aufgesetzt, gesucht, platt wirken. Der Verdacht, weitere «engagierte» Werke dieser Art in Wallins Werkkatalog zu finden, bleibt allerdings ohne Bestätigung, deren Häufung war auf eine unglückliche Programmierung zurückzuführen. Das dritte aufgeführte Werk Wallins vermochte nämlich durchaus zu überzeugen – und ironischerweise kann man es gar politischer hören als die explizit politischen Werke: Too Much of a Good Thing für sechs E-Gitarren und drei Schlagzeuger (1993/2010) ist eine schlagkräftige Musik, von Studierenden der Hochschule Luzern solid interpretiert, aber durchaus ohne aus sich heraus zu kommen.
Das schweizerische Musikschaffen kam an diesem Festival wenig zum Zug, umso mehr als die Produktion regen reiben von canto battuto am Eröffnungsabend vor vollbesetztem Theater Rigiblick vorläufigen Schiffbruch erlitt. Inselhaft sollten sich Werke von Gary Berger, William Blank, Rudolf Kelterborn und Thomas Kessler aus einer das ganze Programm durchziehenden Videoarbeit von Ernst Thoma erheben – die praktisch total ausgefallene Elektronik brachte die Uraufführung dieses «Konzeptprogramms» allerdings zum Scheitern (weitere Aufführungen am 11. und 12. März 2011 in der Stanzerei Baden). Einzige Schweizer Beiträge blieben darüber hinaus die Musik- und Tanzperformance von Rico Gubler (Saxophon), Alfred Zimmerlin (Cello), Hideto Heshiki und Takako Suzuki (Tanz) sowie die Uraufführung von Gérard Zinsstags lasciar vibrar für Ensemble (2010) – mit erfahrungsgesättigter Souveränität greift Zinsstag in diesem umfangreichen Werk, dem ersten, das er am Computer komponierte, auf bewährte kompositorische Strategien zurück.
Von weiterem wäre zu berichten: Von der leidend-leidenschaftlichen Symbiose von Körper und E-Gitarre in Marc Ducrets Solo-Performance; vom Tanzhaus als attraktivem Spielort, der von den Zürcher Konzertveranstaltern bislang noch kaum bestürmt wurde; vom technizistischen Glamour, den das Quatuor Diotima Alberto Posadas Liturgia fractal (2003–08) zugedacht hat; oder von den beiden künstlerischen Leitern, die es auch 2010 vorzogen, sich incognito unters Publikum zu mischen, und die Rolle des «Gesichtes des Festivals» René Karlen zu überlassen, dem Leiter der Abteilung E-Musik der Stadt Zürich mit Flair für lakonisch herzlich-kompetente Ansagen und Moderationen.
Der zu verzeichnende Besucherrekord erlaubt es eigentlich, das Festival 2010 als Erfolg zu verbuchen – obwohl nur wenige Werke nachhaltig haften bleiben –, allerdings muss einmal mehr konstatiert werden, dass sich das Publikum nahezu ausschliesslich aus Vertretern der sogenannten Neue-Musik-Szene gespeist hat. Ausstrahlung über diese Szene hinaus, mindestens bis zu Musik- und Kunstschaffenden in weiteren innovativen Sparten, wäre dringend nötig und – wie sich ansatzweise im Tanzhaus zeigte – auch möglich. Mag sein, dass ein Namenswechsel hierbei praktische Anschubhilfe liefern könnte, der Begriff der «Neuen Musik» besitzt jedenfalls einiges Abschreckungspotential, wie man gelegentlich zwischen dem moods und der Roten Fabrik vernehmen kann. Einem Tabubruch käme ein Namenswechsel nicht gleich, einer Premiere ebenfalls nicht: Als die «Tage für Neue Musik» 1986 erstmals stattfanden, hiessen sie noch «Tage für neue Kammermusik».