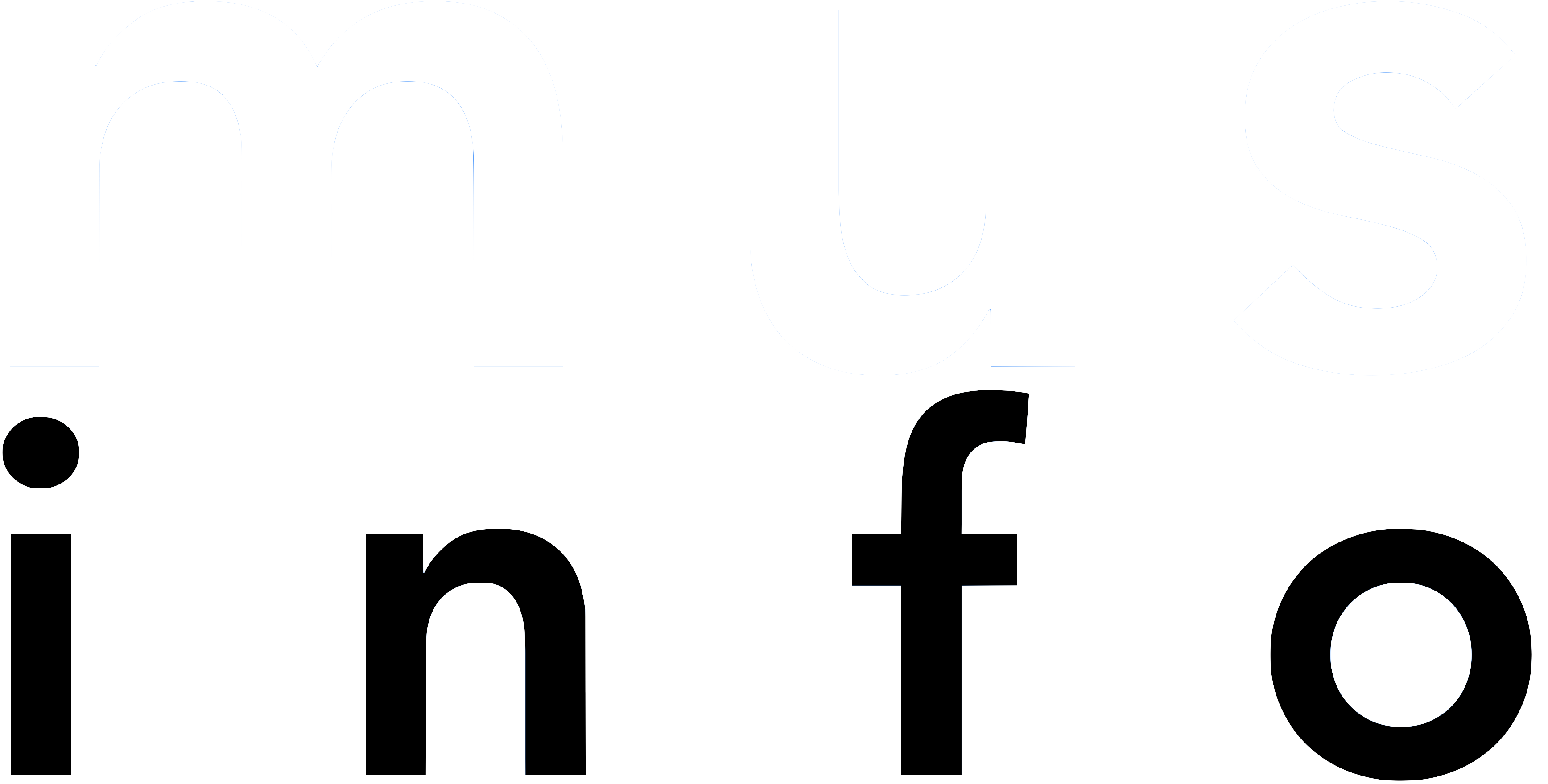Diskurs ohne Folgen
Acht Thesen zu blinden Flecken und Chancen der Kunstmusik
Seit sich die Kunstmusik aus den traditionellen Abhängigkeiten ihrer Auftraggeber gelöst hat, wird um ihre gesellschaftliche Bedeutung immer wieder neu gerungen. Heute kann sie sich in relativer Autonomie weiterentwickeln und wird breit gefördert – durch subventionierte Veranstalter, Hochschulen, Vermittlungsprogramme und anderes mehr. Doch steht sie unter Legitimationszwang und grosser Konkurrenz aus dem zeitgenössischen Kulturangebot, sie muss sich angesichts von Quotendruck, modernen Konsumkanälen und durchlässigen Kunst- bzw. Unterhaltungsbegriffen behaupten. In diesem komplexen Feld verschiedenster Ansprüche verstehen sich die folgenden Thesen als Diskussionsbeitrag in durchaus gewollter Zuspitzung und Verallgemeinerung. Zu jeder These gibt es selbstredend allgemein bekannte Ausnahmen und Gegenpositionen – Werke von John Cage, Dieter Schnebel, Maurico Kagel, Alvin Curran, Chris Newman, Heiner Goebbels, Vinko Globokar, Mathias Spahlinger oder von Ensembles wie Zeitkratzer oder Steamboat Switzerland wären zu nennen. Mit Kunstmusik ist im Folgenden die (zeitgenössische) komponierte Musik gemeint, die in aller Regel von einem Komponisten odereiner Komponistin detailliert aufgeschrieben, anschliessend von Interpreten einstudiert und im Konzertsaal aufgeführt wird, also in der klassischen Arbeitsteilung.
Kunstmusik hat sich in subventionierten Zonen eingerichtet, ihren zuweilen hermetischen Diskurs führt sie mehrheitlich in gesellschaftlichen Randbereichen, im Kreise ihrer Experten. Ihre «message» findet von dort nur schwerlich in die Welt zurück. Sie hat grösste Mühe, den emanzipatorischen Anspruch, den sie verkörpert, mitzuteilen oder gar an die Gesellschaft zu retournieren, dazu fehlen ihr Dockstellen und Scharniere, Übersetzerinnen und Vermittler. Selbst unfreiwillig erfolgreiche Betriebsunfälle oder «falsche» Erfolgstorys, wie sie in anderen Künsten immer wieder vorkommen, findet man hier selten. Wenn sich Pop als mitunter rebellische Marktware gegen bürgerliche Gesellschaftsnormen richtet(e), so ist die Kunstmusik ein bürgerlicher und allgemein akzeptierter Ort der Warenkritik. Diese Kritik wird freilich dort formuliert, wo sie niemandem weh tut: im von der Welt abgeschotteten Konzertsaal. Hier werden mehrheitlich die bereits Eingeweihten in ihrer Milieuzugehörigkeit bestätigt, und ein allfälliges «Ereignis», träte es denn auf, dränge kaum nach draussen (anders etwa als im Theater, das durch seine hohe konkrete Bild- und Sprachkraft immer wieder provozierende Situationen zustande bringt, die ins allgemeine Publikum dringen).
Diese Autonomie in relativer Abgeschiedenheit hat freilich einen grossen Vorteil: Sie garantiert Unabhängigkeit und Freiheit im Diskurs, ähnlich gewissen Gebieten der Grundlagenforschung in den Wissenschaften. Diese findet ebenfalls an speziellen, dafür vorgesehenen Orten statt, es gibt einen gesellschaftspolitischen Konsens über ihre Notwendigkeit und staatliche Förderungswürdigkeit, ohne dass man ihren konkreten Nutzen genau formulieren könnte. Lieber streitet man über die Höhe der Subventionen, die sie in Anspruch nehmen darf.
Die Kunstmusik, für deren Aufführung der Konzertsaal vorgesehen ist (und das ist der grösste Teil), beschäftigt sich vorab mit ihrer eigenen Material-, Konstruktions- und Interpretationsgeschichte und verfügt über ein ausserordentlich differenziertes historisches Bewusstsein und Reflexionsvermögen. Das Konzept des Materialfortschritts war und ist seit langem ihre Triebfeder – es steht aber auch seit langem in der Kritik. Das mit Orchesterinstrumenten produzierbare Material wirkt heute erschöpft, das Neue an der neuen Musik bleibt weitgehend aus. Trotzdem halten sich immer noch weite Teile der «community» an die damit eingebürgerten Rituale und Aufführungsbedingungen. Für sie ist nach wie vor die aktuelle klingende Realität der Lebenswelt ebenso unergiebig wie die Befragung des erweiterten Aufführungskontextes. Klänge und Geräusche oder allzu deutliche Verweise aus der realen Welt sind im Konzertsaal verpönt (die «musique concrète» etwa bleibt in dieser Hinsicht ein historisch wichtiges Abstellgleis, elektronische Musik etwas für Technikbegeisterte).
Aus Berührungsangst vor diesen konkreten Andeutungen pflegt die Kunstmusik lieber ihre eigenen Klischees und hat darüber blinde Flecken entwickelt. So lässt sie beispielsweise Werkzeuge und Rahmenbedingungen – also Instrumentendesign, Raumakustik und -architektur oder Aufführungskontexte – in ihren Werken weitgehend unthematisiert, denn immer noch dominieren die historischen Superstandards wie Stradivari und Steinway, die Frontalbeschallung sowie hochwertige, unifunktionale und schallgedämmte Konzertsäle die Szenerie. In letzteren führt man so genannte neue Musik mit altmodischen Instrumenten auf. Man investiert lieber in experimentelle Spielweisen eines Cellos, als das Cello selbst im Kern in Frage zu stellen. Helmut Lachenmann ist in dieser Hinsicht der Inbegriff eines konservativen Revolutionärs. Eine überlieferte Arbeitsteilung zwischen Komponist, Dirigent, Interpret und Publikum verfestigt diese Zustände ebenso wie die institutionelle Trägheit von Musikhochschulen oder Konzertveranstaltern, auch wenn in den letzten Jahrzehnten vielerorts Gegenbewegungen zu beobachten sind (neue Studiengänge, neue Vermittlungskonzepte, selbstverwaltete Ensembles, mediale Grenzgänge etc.).
Eine weitere Innovationsbremse ist das vorherrschende devote Verhältnis zum (historischen) Text. Jeder Regisseur, der etwas auf sich hält, attackiert heute zum Beispiel Shakespeares Texte, nimmt sich eine Dramaturgie zu Hilfe, streicht Passagen und schreibt andere um. Aber kein Dirigent wagt es, dasselbe mit einer Mahler- oder Wagner-Partitur zu tun. Regietheater ist heute selbstverständlich, Regiemusik immer noch unvorstellbar. Selbst Calixto Bieito oder Christoph Marthaler lassen bei ihren Operninszenierungen den Musiktext weitgehend intakt, während sie anderes radikal umstellen. Dabei wäre gerade ein solches Vorgehen ein ergiebiger Gegenpol zur historisch-informierten Aufführungspraxis. Diese freiwillige Selbstkontrolle und Traditionshaftung ist in keiner anderen zeitgenössischen Kunstpraxis in diesem Ausmass zu beobachten und mitverantwortlich dafür, dass die Kunstmusik wenig Einfluss auf die allgemeine Gehörbildung des Publikums hat. Die konkrete klangliche Verbindung von der Kunstmusik zur Lebenswelt findet nicht statt. (Unvergesslich bleibt mir der interessante Vortrag eines renommierten Musikwissenschaftlers, der sich über feinste Details der Klanggestaltung im Werk eines aktuellen Komponisten äusserte, jedoch nicht bemerkte, dass sein Mikrophon ausgeschaltet war und das Publikum ihn kaum hören konnte.)
Das «Durchbrechen von Hörgewohnheiten», das in Programmtexten mit schöner Regelmässigkeit eingefordert wird, bleibt auf den engen Rahmen der Performance beschränkt. Daraus wächst etwa, was ja durchaus wünschbar wäre, kein Bewusstsein für eine sorgfältige Klanggestaltung des Alltags. Deshalb gibt es auch keine kritische Klangwissenschaft, eine kritische historische beziehungsweise systematische Musikwissenschaft aber sehr wohl. Eine kritische, ganzheitliche Klangwissenschaft könnte aber dazu beitragen, die Errungenschaften der Kunstmusik allgemein zugänglich zu machen.
Ein weiterer Grund für die mangelnde gesellschaftliche Anbindung der Kunstmusik an die realen Verhältnisse ist der fehlende Markt, der bekanntlich alles mit allem verknüpfen kann. Es gibt keine Privatinvestoren, keine Sammler, keinen Primär- und Sekundärmarkt wie in der bildenden Kunst. Eine «Musik Basel» analog zur «Art Basel» ist unvorstellbar, weil es dort nichts zu kaufen gäbe. Schon nur die Frage, wem denn ein Orchesterwerk gehören und was genau bei einem Verkauf den Besitzer wechseln würde, ist unklar: die Partitur? Die Aufführung? Die Aufnahme der Aufführung? Alle zukünftigen Aufführungen? Musik kann man weder an die Wand hängen noch auf einen Sockel stellen, sie eignet sich weder als Investitionsvehikel noch als Kulturbekenntnis in der Eingangslobby eines Konzerns. Sie ist keine «commodity» und folglich geht ihr der dazugehörige Sexappeal völlig ab. Manchmal reicht es für einen privat finanzierten Konzertsaal oder ein gefördertes Ensemble, doch sind dies Investitionen in die Infrastruktur. So bleibt die Kunstmusik schon von ihrer Natur her ein sperriges, aber introvertiertes Korrektiv zu den finanziell getriebenen Teilen des Kunst- und Kulturmarktes – sie eignet sich kaum für Vereinnahmungen oder Dekorationszwecke.
Zentral für die Kunstmusik ist ihre schriftliche Form – Partituren müssen geschrieben, gelesen und interpretiert werden können, was reife handwerkliche Kompetenzen voraussetzt. Diese lineare Logik ermöglicht hohe Komplexität und eine vergleichende Interpretationsgeschichte, verbaut aber einige andere wichtige Zugänge, die in den letzten fünfzig Jahren etabliert worden sind, angefangen bei der elektronischen Musik, die fast gänzlich ohne Partituren auskommt, über alternative Notationsformen und neue Instrumentendesigns bis hin zu Innovationen aus Jazz- oder Popmusiktraditionen oder den neuen digitalen Schnittstellen auf der langen Verwertungskette von Konzeption, Aufnahme, Produktion und Distribution von Musik.
Weil die schriftliche Partitur am Anfang steht und damit die Arbeitsweise der Kunstmusikpraxis weitgehend definiert, sind auch unterwegs die Freiheitsgrade eingeschränkt. Zufälligkeiten in der Probe- oder Studioarbeit, subversiver Einsatz von Technologien und ähnliche Strategien fallen weitgehend dahin. Wenn etwa Helmut Oehring in einem Orchesterwerk Musiker vorsieht, die nicht Noten lesen können, dann versucht er, aus diesem vermeintlichen Defizit ganz gezielt ästhetischen Gewinn zu schlagen. Solche Ausnahmen sind selten. Die Fixierung auf den Notentext hat zudem über viele Jahrzehnte hinweg den Fokus tendenziell vom Akustischen zum Visuellen verschoben und auch die Musikwissenschaft einseitig geprägt – man analysiert zuerst Partituren und erst nachher klingende Ergebnisse, dies auch deshalb, weil es einfacher ist, über Noten als über Klänge zu sprechen.
Die meisten Komponistinnen und Komponisten arbeiten heute alleine. Sie schreiben in langer Arbeit vor, was andere später ausführen. Immer noch gelten konzertante Orchesterwerke oder Opern diesbezüglich als höchste Weihe. In den meisten anderen Künsten sind seit langem erfolgreiche Kollektive am Werk, man denke nur an Fischli/Weiss, die Coen Brothers, Herzog & de Meuron oder ans Theater. Die einsame Arbeitsweise des Komponisten – ein Erbe des historischen Genie- und Avantgardistenbegriffs – lässt wenig Zufall, Dialog oder soziale Dynamik zu. Die Chancen, die sich daraus ergeben würden, lässt die Kunstmusik aus (ironischerweise schreiben aber zuweilen Komponisten einen Aufführungskontext vor, der dann quasi auf Befehl grosse soziale Dynamik auslösen soll). Der herkömmlich arbeitende Komponist gleicht also dem Koch, der einen langen Einkaufszettel schreibt, seine Zutaten einkauft und von seiner Küchenbrigade exakt nach Rezept ein komplex komponiertes Gericht zubereiten lässt. Vor dem Servieren ist er zuständig für die Qualitätskontrolle. Der herkömmliche Popkünstler andererseits gleicht dem Koch, der mit seinen Partnern und gewissen Präferenzen vor dem gefüllten Kühlschrank steht und sich fragt, was man aus dem Inhalt zubereiten könnte. Er lässt sich stark von Material, Mitmenschen und Küchenkontext treiben. Keiner der beiden Zugänge ist per se besser oder interessanter und beide haben ihre jeweiligen Beschränkungen. Aber beide könnten mehr voneinander profitieren als sie es gemeinhin tun.
Wenn sich Kunstmusik durch eine kleine Schnittfläche zur gesellschaftlichen Realität auszeichnet, dann hat Popmusik oft zuviel davon. Sie bezahlt ihre affirmative Nähe zur Technologie und zum Markt mit der potentiellen Vereinnahmung als Schmiermittel der Musikindustrie und zu Werbezwecken. Früher war Pop Ausdruck eines mindestens gefühlten Generationenkonflikts und besass erhebliches Irritationspotential, und dies nicht nur wegen langer Männerfrisuren oder zerstörten Hotelzimmern, sondern ebenso aus formalmusikalischen und inhaltlichen Gründen. Doch schnell begriff man, wie sich musikalische Rebellion in gutes Geld verwandeln lässt, entsprechende Anpassungsprozesse kamen in Gang. Popmusik wandelte sich so vom Konfliktbotschafter zum Konsensmedium, heute ist sie der omnipräsente Soundtrack der Dienstleistungsgesellschaft und muss sich nicht mehr zwischen Party und Opposition entscheiden, letzteres war einmal. Aus Subkultur wird Kommerzware – ein bekanntes Muster der Popkultur. Das heisst nicht, dass es heute keinen interessanten, provozierenden Pop mehr gäbe, aber seine hohe Verwertbarkeit steht im ständigen Gegensatz zu einer möglichen pointierten Aussage. Die letzte Symbolfigur, die die Passage vom Underground-Helden zum globalen Medienstar mit einem tragischen Ende respektive einer Schrotflinte besiegelte, war Kurt Cobain. Er erinnert heute daran, dass es so etwas wie Underground überhaupt einmal gab. Seither dominieren verschiedenste Retrowellen den Markt und die Eltern vermeintlich Hochbegabter feuern ihre Kinder heute in Casting-Shows zu Höchstleistungen an. Eine muffige Toleranz seitens des Feuilletons (so es noch existiert) federt das Ganze ab.
Pop hat Angst vor zuviel Konstruktion. Wenn es zu kompliziert, zu lang, zu dynamisch, zu abwechslungsreich wird, dann passt diese Musik nicht mehr in die Verwertungskanäle und Rezeptionsmuster. Pop ist die Kunst, differenzierte Gefühlslagen, Inhalte und Botschaften in relativ standardisierte Formen zu giessen. Das Komplexe daran ist darum nicht die Komposition, die hohe Fertigkeit, die Virtuosität jeglicher Art, sondern vielmehr die Textur, die Klanglichkeit, das Spiel der mehrfach und ständig neu codierten Referenzen von Sound, Style, Sprachgebrauch, Technologie, Emotion, Outfit etc. sowie die Möglichkeit, eine zeittypische Form von Erregung auszulösen. Alle dürfen bei diesem Versuch voraussetzungslos mitmachen – zur Kenntnis genommen wird, was auf irgendeiner Plattform der Unterhaltungsindustrie Differenz produziert. Dabei plündert Popmusik fortwährend den globalen Selbstbedienungsladen, funktioniert als hemmungslose Umarmungsmaschine und führt deshalb tendenziell einen Vereinnahmungsdiskurs, zum Teil sogar Richtung Kunstmusik. Diese dagegen hat ihre Praxis und Rezeption an Vorwissen, überprüfbare Fertigkeiten, differenzierte Verschriftlichung, strenge Aufführungsrituale oder allgemeiner: an institutionelle Hürden geknüpft, sie führt tendenziell einen Ausgrenzungsdiskurs. Das mag mit ein Grund sein, weshalb sie sich wenig um Errungenschaften aus der experimentellen Popmusik kümmert.
Alternativen sind selbstredend nicht in der Mitte zu suchen, nicht dort, wo sich realitätsverliebte Komponistenkollektive mit lockeren Partituren in neuen Aufführungsorten auf publikumsfreundliches Mittelmass herunternivellieren, indem sie Komplexität reduzieren und Marktbedingungen respektieren. Die absolute Weltvergessenheit im akustischen «white cube» muss weiterhin möglich sein und verteidigt werden, sie beschert uns immer wieder Momente höchster Ergriffenheit und Einsicht. Parallel dazu würde es der historischen wie zeitgenössischen Kunstmusik aber gut anstehen, etwas weniger Respekt vor der eigenen Tradition und ihren Formen und Ritualen, ihren Texten und Standards, ihren Lehr- und Lernformen zu zeigen, mehr aktives Ausfransen an den Rändern und Medien zu betreiben, mehr rebellischen Umgang mit Technologien und (neuen) Instrumenten zu pflegen, mehr Rückeroberung gesellschaftlicher Plattformen einzufordern und vermehrt Kooperationen mit anderen zeitgenössischen Kunstpraxen einzugehen. Das könnte dazu beitragen, die Kunstmusik aus ihren oft selbstgewählten Reservaten zu holen und sie als selbstverständliche Ausdrucksform zu akzeptieren, wie wir das im Falle von Literatur, bildender Kunst oder vom Film gewohnt sind. Dann wären vielleicht die zahlreichen Vermittlungsprogramme für zeitgenössische Musik irgendwann überflüssig. Diese sind heute wichtig und wünschenswert, kaschieren aber nicht die Tatsache, dass da jemand eben immer auch Vermittlung braucht, weil seine Botschaft in Reinform auf zu wenig Anteilnahme stösst und unverstanden bleibt.